Yoga & Trauma, wie kann eine traumasensible Yoga Praxis Menschen heilsam unterstützen?
- Frederike von Hacht
- 12. Sept. 2025
- 11 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 15. Sept. 2025
von Frederike von Hacht, Teilnehmerin YOGA 300/ 2025
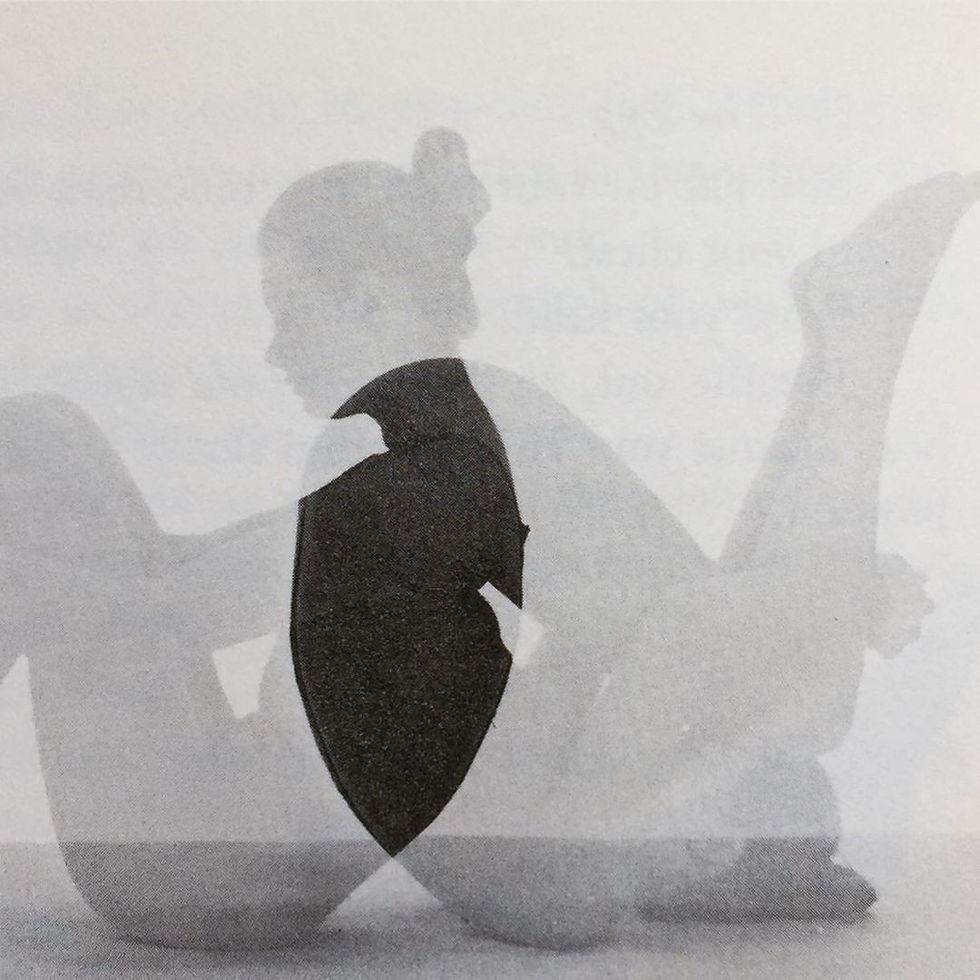
Traumasensibles Yoga
Wir sprechen heute so oft über „Trauma“ wie nie zuvor. In Podcasts, auf Social Media und
in Büchern begegnet uns der Begriff immer häufiger. Und doch bleibt oft unklar, was
eigentlich gemeint ist. Denn nicht jede schwierige Situation oder belastende Erfahrung ist ein Trauma.
Ein Trauma geht tiefer als ein alltägliches Ereignis. Es erschüttert das Gefühl von Sicherheit und hinterlässt Spuren, sowohl im Körper als auch in der Psyche.
Gerade hier kann Yoga ins Spiel kommen. Denn während klassische Therapien oft über
kognitive Zugänge und Sprache arbeiten, setzt Yoga beim Körper an. Doch was bedeutet
das genau? Was unterscheidet Trauma von alltäglichen Belastungen und wie kann eine
traumasensible Yogapraxis heilsam unterstützen?
Was bedeutet Trauma eigentlich?
Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „Wunde“.
Ursprünglich bezeichnete es eine körperliche Verletzung. In der heutigen Psychotraumatologie wird der Begriff jedoch vor allem im Sinne einer seelischen Verletzung verstanden: eine Erfahrung, die das Sicherheitsgefühl und die Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen so massiv überfordert, dass es zu einer dauerhaften psychischen und/oder körperlichen Erschütterung kommt.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Trauma und Traumatisierung. Während „Trauma“ das belastende Ereignis beschreibt, meint „Traumatisierung“ die individuelle Reaktion eines Menschen darauf. Nicht jedes potenziell traumatische Ereignis führt zwangsläufig zu
einer Traumatisierung. Entscheidend ist, ob die Situation als überwältigend, unausweichlich und hilflos machend erlebt wird und ob die natürliche Stressverarbeitung unterbrochen wird.
Kann das Erlebte weder psychisch noch körperlich integriert werden, entsteht eine Art
„Erstarrung“ im Nervensystem: Das Trauma bleibt als körperlich-emotional gespeicherte
Überlebensreaktion „stecken“. In der Fachliteratur werden verschiedene Formen potenziell traumatischer Erfahrungen unterschieden:
• Schocktrauma (Monotrauma): ein einzelnes, plötzliches, überwältigendes Ereignis (z. B.
Unfall, Naturkatastrophe).
• Komplextrauma: wiederholte oder anhaltende traumatische Erfahrungen über längere
Zeit (z. B. Gewalt, Missbrauch, Krieg).
• Entwicklungstrauma: Form des Komplextraumas, das in sensiblen
Entwicklungsphasen der Kindheit entsteht und die gesunde Reifung beeinträchtigt.
• Bindungstrauma: Form des Komplextraumas durch unsichere, instabile oder
missbräuchliche frühe Bindungsbeziehungen; prägt spätere Beziehungserfahrungen
und Selbstbild.
Ob daraus eine Traumatisierung entsteht, hängt von den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten ab. Aus Traumatisierungen können psychische Störungen wie
die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder komplexe PTBS hervorgehen.
Darüber hinaus zeigen sich Traumafolgen sehr unterschiedlich und betreffen oft Körper,
Psyche und zwischenmenschliche Beziehungen zugleich. Betroffene können
beispielsweise unter starker innerer Unruhe, Ängsten, Schlafstörungen oder
Stimmungsschwankungen leiden. Manche ziehen sich zurück oder fühlen sich innerlich
wie abgeschnitten, andere erleben intensive Flashbacks oder überwältigende Gefühlsausbrüche. Häufig treten auch körperliche Beschwerden auf, etwa chronische
Schmerzen, Magen-Darm-Probleme oder anhaltende Erschöpfung. Typisch ist, dass
traumatisierte Menschen Schwierigkeiten haben können, sich sicher zu fühlen, sowohl im
eigenen Körper als auch in Beziehungen. Sie sind schneller überlastet, reagieren empfindlich auf bestimmte Auslöser und verlieren leichter das Gefühl, in ihrer Mitte zu sein.
Solche traumabedingten Stresssymptome haben eine klare physiologische Grundlage.
Das Verständnis dieser Prozesse und der beteiligten Strukturen ist entscheidend, um zu
begreifen, wie traumasensibles Yoga einen Menschen unterstützen kann.
Der Körper im Alarmzustand
Wird eine bedrohlich wirkende Situation wahrgenommen, aktiviert sich automatisch unser
Überlebenssystem. Dabei spielen zwei Regulationssysteme eine zentrale Rolle:
• das autonome Nervensystem (ANS)
• das endokrine System
Das ANS, auch vegetatives Nervensystem genannt, steuert lebenswichtige Funktionen wie
Atmung, Herzschlag oder Verdauung und arbeitet unabhängig von bewusster Kontrolle. Es
besteht aus zwei Hauptzweigen, die im Zusammenspiel den Wechsel zwischen
Aktivierung und Entspannung steuern:
• das sympathische Nervensystem, das den Körper in Gefahrensituationen blitzschnell
mobilisiert („Kampf oder Flucht“)
• das parasympathische Nervensystem, das Entspannung, Heilung und Regeneration
ermöglicht
In einer Bedrohungssituation signalisiert der Sympathikus dem Körper, Stresshormone wie
Adrenalin und Noradrenalin auszuschütten. Dadurch steigen Herz- und Atemfrequenz und
die Muskeln werden angespannt. Parallel dazu wird die Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennieren-Achse (HHN-Achse, auch„Stressachse“ genannt) aktiviert, die unter
anderem die Ausschüttung von Cortisol, unserem wichtigsten Stresshormon, bewirkt.
Nach Abklingen der Bedrohung übernimmt normalerweise der Parasympathikus. Er leitet
die Entspannung ein und ermöglicht es dem Körper, nach der hohen Anspannung wieder
in einen Zustand der Regeneration zurückzukehren.
Ein zentraler Bestandteil des parasympathischen Systems ist der Vagusnerv, der in der
sogenannten Polyvagal-Theorie (nach Stephen Porges) in zwei Äste unterschieden wird:
• ventraler Vagus: vermittelt soziale Verbundenheit, Sicherheit und Co-Regulation. Er ist
aktiv, wenn wir uns sicher fühlen, z. B. in vertrauensvoller Nähe zu einem Freund oder
einer Freundin. Unter subtilen Stressbedingungen, beispielsweise ein ablehnender
Gesichtsausdruck oder ein angespannter Tonfall, kann er auch Anpassungsreaktionen
auslösen, die als „Fawning“ (äußerlich freundliche Offenheit bei gleichzeitig innerem
Rückzug) beschrieben werden.
• dorsaler Vagus: wird aktiv, wenn weder Kampf noch Flucht möglich sind. Er bewirkt
einen Shutdown-Zustand: Kreislauf und Atmung verlangsamen sich, Betroffene erstarren
oder dissoziieren.
Diese körperlichen Reaktionen hängen eng mit unserem Gehirn zusammen. Ein
vereinfachtes Erklärmodell hierfür ist das „Dreieinige Gehirn“ nach Paul D. MacLean.
Es unterscheidet drei funktionelle Ebenen des Gehirns:
• Stammhirn (Reptiliengehirn): steuert grundlegende Überlebensfunktionen wie Atmung,
Herzschlag und Reflexe sowie unwillkürliche Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktionen.
• Limbisches System: verarbeitet Emotionen, Bindung und episodisches Gedächtnis. Hier
liegen u. a. die Amygdala (Angst- und Gefahrenverarbeitung) und der Hippocampus
(zeitliche Einordnung von Erlebnissen).
• Neokortex: jüngster Teil des Gehirns; zuständig für höhere kognitive Funktionen wie
Sprache, Denken, Selbstreflexion, Impulskontrolle und Planung.
In einer traumatischen Situation übernimmt unser Stammhirn, das einzig auf Überleben
ausgerichtet ist. Gleichzeitig fährt der Neokortex herunter, denn würden wir erst anfangen,
die beste Fluchtroute abzuwägen, hätte uns in früheren Zeiten der Säbelzahntiger längst
erwischt. Die Amygdala reagiert überaktiv, während der Hippocampus seine Fähigkeit verliert, Erlebnisse zeitlich einzuordnen. Auch die sprachliche Verarbeitung wird blockiert.Traumatische Erfahrungen werden daher häufig als sprachlos, überwältigend und „zeitlos“ erlebt. Sie sind körperlich gespeichert, aber nicht integriert.
Wenn wir eine Situation erleben, in der unser autonomes Stresssystem aktiviert wird, wir
den daraus resultierenden Handlungsimpulsen jedoch nicht folgen können, um uns in
Sicherheit zu bringen, bleibt diese Reaktion im Körper gewissermaßen „stecken“. Unser
Organismus hat dann zwar Alarm ausgelöst und Energie für Kampf oder Flucht
bereitgestellt, da wir diese aber nicht nutzen konnten, wird sie nicht vollständig abgebaut.
Im Alltag geschieht das auch im Kleinen, wenn uns zum Beispiel ein volles E-Mail-
Postfach stresst. Das Nervensystem reagiert, als wären wir in Gefahr und aktiviert die
beschriebene Überlebensreaktion. Doch wir können nicht einfach vor den E-Mailsdavonlaufen. Stattdessen bleiben wir sitzen, während Stresshormone wie Adrenalin und
Cortisol im Körper zirkulieren und nur unzureichend abgebaut werden.
In einer traumatischen Situation ist dieser Mechanismus um ein Vielfaches intensiver. Das
Nervensystem schaltet vollständig in den Überlebensmodus, doch Kampf oder Flucht sind
meist nicht möglich. Der Körper verharrt in einem Zustand ständiger Alarmbereitschaft
oder innerer Starre, weil die eingeleitete Überlebensreaktion nicht ausgeführt werden konnte.
Daraus können viele der typischen Symptome einer Traumatisierung entstehen. Hierzu
zählen zum Beispiel eine anhaltende innere Alarmbereitschaft, Flashbacks, Schlafstörungen oder das Gefühl, vom eigenen Körper abgeschnitten zu sein.
Diese Reaktionen lassen sich gut mit dem Modell des Toleranzfensters von Daniel Siegel
beschreiben. Es veranschaulicht den Bereich innerer Erregung, innerhalb dessen ein
Mensch Informationen aufnehmen und sich selbst regulieren kann. „Kippt“ das Nervensystem aus diesem Bereich heraus, entstehen zwei typische Zustände:
• Übererregung (Hyperarousal): meist sympathikoton vermittelt; gekennzeichnet durch
z.B. Panik, Unruhe, Reizbarkeit oder Konzentrationsprobleme.
• Untererregung (Hypoarousal): häufig über den dorsalen Vagus vermittelt;
gekennzeichnet durch z.B. innere Leere, Rückzug, „sich abgeschnitten fühlen“.
Yoga und das Gehirn
Die Forschung zu den Wirkungen von Yoga auf unser Gehirn steckt noch vergleichsweise
in den Anfängen. Dennoch gibt es bereits einige vielversprechende Studien, die Veränderungen in genau den Gehirnregionen nachweisen, die für Stressverarbeitung und Emotionsregulation besonders wichtig sind. So konnte etwa gezeigt werden, dass Yoga die Aktivität der Amygdala, unserem „Alarmzentrum“ für Gefahr reduziert und gleichzeitig den Cortisolspiegel senkt (Desai et al., 2015; Gotink et al., 2018).
Bei Frauen mit komplexer Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) fanden Forscher
zudem Hinweise darauf, dass Yoga die Aktivität in Hirnarealen steigert, die mit Selbstwahrnehmung und Eigenregulation verbunden sind, wie der Insula und dem präfrontalen Cortex (van der Kolk et al., 2014).
Wie traumsensibles Yoga unterstützen kann
Wie wir gesehen haben, wirkt eine Traumatisierung nicht nur im Geist, sondern vor allem
im Körper und entzieht sich oft der rein kognitiven, sprachlichen Verarbeitung. Bessel van
der Kolk beschreibt Trauma daher treffend als „körperlich“. Genau hier setzt ein
körperorientierter Zugang wie Yoga an. Er kann eine wertvolle Ergänzung und
Unterstützung auf dem Heilungsweg sein.
Traumasensibles Yoga kann dazu beitragen, das beschriebene Toleranzfenster eines
Menschen sanft zu erweitern, also den Bereich, in dem Emotionen und Körperempfindungen regulierbar bleiben. Es kann stabilisierende Erfahrungen ermöglichen und über das achtsame Spüren von Körper, Atem und inneren Zuständen die Selbstwahrnehmung behutsam stärken. Auf diese Weise kann der Weg geebnet werden, den eigenen Körper wieder als sicheren Ort zu erleben (Emerson & Hopper, 2011).
Yoga kann sowohl die Selbstwahrnehmung fördern als auch Ressourcen für die
Selbstregulation stärken. Auf diese Weise unterstützt es den Aufbau eines stabilen inneren
Fundaments, das oft notwendig ist, damit sich Menschen den therapeutischen Prozessen
in zumutbarer Weise zuwenden können (van der Kolk et al., 2014). Yoga ersetzt keine
psychotherapeutische oder medizinische Behandlung. Es kann den Prozess jedoch
wirksam begleiten und sinnvoll ergänzen, indem es Stabilisierung fördert, Ressourcen
stärkt und wichtige Voraussetzungen für Therapie schafft.
Ursprung und Prinzipien
Die erste klar definierte Form traumasensiblen Yogas wurde am Trauma Center in
Brookline, Massachusetts (USA) von David Emerson in Zusammenarbeit mit Bessel van
der Kolk entwickelt. Das daraus entstandene „Trauma Center Trauma Sensitive Yoga“
(TCTSY) ist eine standardisierte, forschungsbasierte und markenrechtlich geschützte
Methode. Sie darf nur von speziell ausgebildeten, zertifizierten Facilitators angeboten
werden. Im Mittelpunkt steht die Wiederherstellung von Selbstwahrnehmung, Autonomie
und Körperkontakt bei Menschen mit komplexen Traumatisierungen.
Der allgemeinere Begriff „traumasensibles Yoga“ (TSY) ist dagegen im deutschsprachigen
Raum nicht geschützt oder standardisiert. Er bezeichnet jede Form von Yogapraxis, die
sich an den besonderen Bedürfnissen traumatisierter Menschen orientiert. In den letzten
20 Jahren hat sich TSY aus verschiedenen Kontexten entwickelt, insbesondere in
Verbindung mit moderner Traumatherapie, Achtsamkeitspraxis und körperorientierter
Psychotherapie. Bedeutende Impulse kamen im deutschsprachigen Raum von Angela
Dunemann, Marina Weiser, Nadja Pfahl, Nicole Härle und Eva Weinmann. Sie beziehen
sich teilweise auf US-amerikanische Modelle, gestalten TSY jedoch methodisch freier,
integrativer und stärker sozialpädagogisch bzw. therapeutisch begleitend.
Im TCTSY wurden vier Kernpunkte herausgearbeitet, die beschreiben, wie Yoga
traumatisierte Menschen wirksam unterstützen kann. Auch wenn TCTSY ein
standardisiertes Verfahren ist, können diese Kernideen heute als allgemeine Leitlinien für
eine traumasensible Yogapraxis angesehen werden und eine gute Orientierung bieten.
1. Das Erleben des gegenwärtigen Augenblicks
Bessel van der Kolk beschreibt Trauma als „die Krankheit, nicht präsent sein zu
können“. Viele Betroffene sind ständig auf mögliche Gefahren fokussiert und können
das Hier und Jetzt kaum wahrnehmen. TSY unterstützt, diese Orientierung allmählich
zu verlagern: weg vom Trauma, hin zum Jetzt. Die Erfahrung, körperlich im Moment zu
sein, schafft Sicherheit und Erdung.
2. Entscheidungsmöglichkeiten und Selbstwirksamkeit
Traumatische Erfahrungen gehen oft mit Kontrollverlust einher. Wahlmöglichkeiten in
der Yogapraxis sind daher bedeutsam: Sie symbolisieren Selbstbestimmung und
stärken das Vertrauen in die eigenen Grenzen. Schritt für Schritt können die
Teilnehmenden wieder lernen, Körpersignale wahrzunehmen und ihr Erleben aktiv zu
gestalten.
3. Effektives Handeln ermöglichen
In traumatischen Situationen war Handeln oft nicht möglich, obwohl der Körper dazu
bereit war. Diese unterbrochenen Reaktionen bleiben gespeichert. TSY bietet die
Chance, in einem sicheren Rahmen kleine Handlungen bewusst zu erleben, etwa eine
Haltung zu verändern oder um Unterstützung zu bitten. So wird erfahrbar, dass eigene
Bewegung, Entscheidung und Veränderung möglich und sicher sind.
4. Rhythmen, Synchronie und Zeitwahrnehmung
Komplexe Traumata können dazu führen, dass Menschen sich „aus dem Takt“ fühlen,
mit sich selbst, mit anderen und mit der Zeit. TSY setzt auf Atem, Bewegung und klare
Abläufe, um Rhythmus und Orientierung zurückzugewinnen. Rhythmus vermittelt
Struktur, Vorhersagbarkeit und Zugehörigkeit.
Diese Kernpunkte beschreiben die grundlegenden Wirkprinzipien traumasensibler
Yogapraxis. Damit sie in der Praxis wirksam werden, braucht es jedoch bestimmte Modifikationen, die sich von klassischen Yogastunden unterscheiden können. Daraus
ergeben sich Prinzipien, auf die Yogalehrende achten können.
Ein wesentliches Prinzip ist die Einladung statt Anleitung. Die Sprache ist dabei
durchgängig nicht-direktiv. Lehrende nutzen Formulierungen wie „wenn du möchtest“, „du
könntest ausprobieren“ oder „schau, ob du spüren kannst...“. Das unterstützt ein Gefühl
von Selbstbestimmung, das für Menschen mit Traumatisierung besonders wichtig ist.
Eng damit verbunden ist die Wahlfreiheit und Kontrolle. Teilnehmende entscheiden
selbst, ob und wie sie sich bewegen. Die Möglichkeit, jederzeit zu pausieren, eine Asana
anzupassen oder nicht auszuführen, kann einen Rückgewinn von Kontrolle darstellen.
Auch kleine, konkrete Handlungen wie das eigenständige Holen einer Decke oder das
Bitten um Unterstützung können das Gefühl von Wirksamkeit fördern. Diese scheinbar
einfachen Entscheidungen können nachhaltig die Fähigkeit zu effektivem Handeln stärken.
Ein weiteres Prinzip ist die Körperwahrnehmung statt Formorientierung. Die
Aufmerksamkeit wird auf interozeptive Empfindungen gelenkt, beispielsweise auf
Muskelspannung oder Atembewegung. Dadurch wird die Verbindung zum Körper gestärkt
und die Fähigkeit gefördert, innere Zustände zu registrieren, zu tolerieren und selbst zu
modulieren. Das achtsame Spüren des Körpers kann außerdem die Verankerung im Hier
und Jetzt unterstützen.
Darüber hinaus wird in der Regel auf Körperkontakt verzichtet.
Das TCTSY verzichtet vollständig auf körperliche Hilfestellung durch die Lehrperson.
Stattdessen liegt der Fokus auf Selbstbeobachtung und Selbstwirksamkeit. Das schafft
Sicherheit, reduziert Triggerpotenzial und schützt individuelle Grenzen.
Ein weiteres Prinzip betrifft ein kontextsensibles Setting. Die Struktur der Stunden ist klar
und vorhersehbar. Rituale, Raumgestaltung und die Haltung der Lehrperson orientieren
sich an den Grundprinzipien von Sicherheit, Orientierung und Transparenz.
Dazu gehört zum Beispiel, dass die Lichtverhältnisse konstant bleiben und der Raum
während Savasana nicht abgedunkelt wird, wenn das Licht vorher eingeschaltet war.
Hinzu kommt das Vermeiden von Extremen. Trauma geht oft mit Schwankungen
zwischen Übererregung und Erschöpfung einher. Traumasensibles Yoga arbeitet daher mit
ruhigen Sequenzen und vielen Pausen, während auf intensive Vinyasa-Flows oder lang
gehaltene Yin-Haltungen in der Regel verzichtet wird.
Auch Savasana wird angepasst. Entspannung setzt Sicherheit voraus. Daher kann
Savasana auch im Sitzen stattfinden, unterstütz durch eine Wand. Orientierung im Raum,
visuelles Benennen der Umgebung oder Eigenberührungen können das Sicherheitsgefühl
zusätzlich fördern.
Das nächste Prinzip betrifft das Pranayama. Atem kann beruhigen, aber auch triggern.
Deshalb sollten keine regulierenden Atembefehle gegeben werden. Statt „tief einatmen“ ist
es hilfreicher zu sagen: „Vielleicht magst du deinen Atem beobachten, wenn das gerade
passt.“ Zusätzlich können visuelle Anker oder synchronisierte Handbewegungen
eingesetzt werden.
Bei den Asanas sind vor allem solche empfehlenswert, die Orientierung, Stabilität und
Selbstwirksamkeit unterstützen. Dazu gehören Standhaltungen wie Tadasana oder die
Helden, die Erdung und Kraft fördern, Balancehaltungen, die Konzentration und Präsenz
unterstützen, oder Varianten mit Stuhl und Wand, die Stabilität und Schutz ermöglichen.
Weniger geeignet sind hingegen Haltungen, die Schutzlosigkeit hervorrufen können, wie
„Happy Baby“, oder Sequenzen, in denen wenig Orientierung im Raum gegeben ist, beispielsweise längere Übungen im Liegen.
Fazit
Traumasensibles Yoga schafft sichere Erfahrungsräume, in denen Menschen lernen
können, ihren Körper wieder zu bewohnen, sich zu regulieren und in Verbindung zu treten.
Es ist weniger eine eigene Form des Yogas und mehr eine Haltung, die durch Sprache,
Struktur, Achtsamkeit und ein respektvolles Beziehungsangebot vermittelt wird.
Entscheidend für Yogalehrende ist ein informierter, achtsamer und sensibler Umgang.
In der traumasensiblen Arbeit wird oft betont, dass ein sensibel gestalteter Yogaunterricht
nicht nur für Menschen mit Traumatisierung hilfreich sein kann, sondern grundsätzlich für
alle Menschen, die in den Yogaunterricht kommen. Denn wir alle bringen Verletzungen und
schwierige Erfahrungen mit, auch wenn diese nicht traumatisch sind. Gleichzeitig ist es
wichtig, klar zwischen alltäglichen Belastungen und echten Traumata zu unterscheiden.
Nur so können Räume entstehen, in denen Menschen mit Traumaerfahrungen die
Sicherheit finden, die sie für ihre Yogapraxis und ihren Heilungsweg brauchen.
Literaturverzeichnis
Weinmann, E. (2023). Wenn dein Körper sich erinnert: Mit traumasensiblem Yoga den Körper wieder als sicheren Ort spüren. E-Book-Ausgabe. München: Knaur Balance eBook 2023.
König, V. (2021) Bin ich traumatisiert? Wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen. München: Knaur.Leben 2023.
Emerson, D. & Hopper, E. (2012). Trauma-Yoga: Heilung durch sorgsame Körperarbeit ; therapiebegleitende Übungen für Traumatherapeuten, Yogalehrer und alle, die ihren Körper heilen wollen. 5. Aufl. Lichtenau: G.P. Probst Verlag 2024. (Originaltitel: Overcoming Trauma through Yoga. Reclaiming Your Body.)
Onlinequellen
o. V. (2024, 29. Juni).Trauma und Yoga: Sicherheit finden im Körper. YogaEasy.
https://www.yogaeasy.de/artikel/trauma-und-yoga-sicherheit-finden-im-koerper [Zugriff am 16.05.2025].
Ryan, J. (2012, 18. März). Trauma and Yoga: Transformation Through the Body. Elephant Journal.
[Zugriff am 15.05.2025].
Weinmann, E. (2025, 12. Januar). Traumasensibles Yoga - Yoga und Therapie. Yoga und Therapie.
https://yogaundtherapie.info/traumasensibles-yoga/ [Zugriff am 16.05.2025].
Reagan, L. (2025, 06. Mai). Trauma Sensitive Yoga In Therapy - With David Emerson. Therapy Chat
Podcast.
https://www.therapychatpodcast.com [Zugriff am 13.05.2025].
Van der Kolk, B. A. (o.D.). Offizielle Website. Baddel van der klok.
unter: https://www.besselvanderkolk.com [Zugriff am 16.05.2025]
Studien
Desai, R., Tailor, A., & Bhatt, T. (2015). Effects of yoga on brain waves and structural activation: A review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(2), 112–118.
Gotink, R. A., Meijboom, R., Vernooij, M. W., Smits, M., & Hunink, M. G. (2018). 8-week mindfulness based stress reduction induces brain changes similar to traditional long-term meditation practice – A systematic review. Brain and Cognition, 108, 32–41.
van der Kolk, B. A., Stone, L., West, J., Rhodes, A., Emerson, D., Suvak, M., & Spinazzola, J. (2014). Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Bessel van der Kolk.
Emerson, D., & Hopper, E. (2011). Overcoming trauma through yoga: Reclaiming your body. North Atlantic Books.



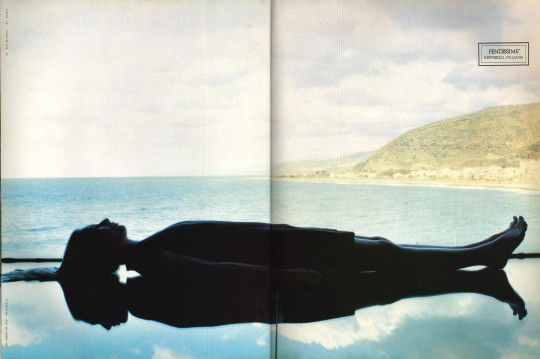


Kommentare